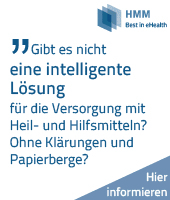Wie innovativ ist Deutschlands Gesundheitswesen?
In Deutschland scheitern Innovationen zu oft auf ihrem Weg ins Gesundheitswesen. Wie dies besser und dabei zugleich die medizinische und pflegerische Versorgung effizienter werden kann, diskutierten heute hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesundheitswesen auf dem BARMER-Versorgungs- und Forschungskongress 2025 in Berlin. Neben politischen und strategischen Fragen ging es um Beispiele aus der Praxis und internationale Erfahrungen. „Deutschland bietet eine sehr innovationsfreundliche Umgebung. Es bringt hohe Ressourcen für Forschung und Entwicklung auf, doch von deren Ergebnissen kommt zu wenig in der Versorgung an“, so Prof. Dr. med. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER. Sichtbar werde dies etwa, wenn man die Verfügbarkeit innovativer Arzneimittel mit den Ergebnissen der Gesundheitsversorgung vergleiche. So leiste sich Deutschland eine hohe Verfügbarkeit innovativer Arzneimittel und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung von über 50 Milliarden Euro jährlich. Steigende Ausgaben würden vor allem durch patentgeschützte Innovationen getrieben. Doch gemessen an Gesundheitsergebnissen wie der Lebenserwartung oder der Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen schneide Deutschland im internationalen Vergleich nur unterdurchschnittlich ab. Aus der Sicht gesetzlicher Krankenkassen müssten neue Erkenntnisse daher in der Selbstverwaltung um- und durchgesetzt werden. Dabei sei Evidenz der Wirksamkeit der beste Maßstab für die Bewertung aller Interventionen. Die Instrumente zu ihrem Nachweis müssten sich jedoch wandelnden Technologien anpassen. Straub: „Wir benötigen neuartige Methoden für den Nutzennachweis und eine übergreifende Anpassung von Strukturen und Prozessen, zur optimalen Integration der Innovationen.“
Perspektiven aus Politik, Industrie und Wissenschaft
Wie Innovationen ins System der gesundheitlichen Versorgung gelangen, beleuchteten auf dem Versorgungs- und Forschungskongress prominente Stimmen aus Politik, Selbstverwaltung, Industrie und Wissenschaft. Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement der Universität Bielefeld und Moderator des Kongresses, betonte dabei den Charakter von Innovationen als Prozess schöpferischer Zerstörung. Innovationen scheiterten im Gesundheitswesen an einem Mix aus hohen Kosten, Unsicherheit über den Nutzen einer Innovation sowie institutionellen Risiken. Auch die Angst vor Veränderungen und die Trägheit des Systems behinderten Innovationen. Ansätze für ein Innovationsmanagement sehe er, so Greiner, zum Beispiel im Innovationsfonds, in Modellvorhaben oder der Regulierung des Zugangs von Innovationen. „Viele Innovationshürden im System sind längst bekannt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns ihrer annehmen“, so Tino Sorge, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit. Prof. Josef Hecken, Unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses, machte deutlich: „Ein Projekt ist nur dann wirklich innovativ, wenn schon im Antrag klar ist, wie es in die Versorgung finden kann.“ Dr. Robert Welte, Senior Director Market Access & Reimbursement und Mitglied der Geschäftsführung der Gilead Science GmbH, legte die Perspektive der Industrie dar: „Innovative Therapieansätze, die einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf auch kleiner Patientenpopulationen adressieren, sowie die sich daraus ergebenden Studiendesigns erfordern die Weiterentwicklung des AMNOG sowohl hinsichtlich der Nutzenbewertung als auch der Preisfindung. Zudem sollten gemeinsam Wege gefunden werden, wie Sprunginnovationen in den Bereichen Prävention und Therapie schneller beim Patienten ankommen.“ Die Sichtweise des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege auf die Einführung von Innovationen legte Prof. Dr. rer. oec. Leonie Sundmacher, Fachgebietsleitung Gesundheitsökonomie an der School of Medicine & Health an der Technischen Universität München, dar.
Praxisbeispiele gelungener Innovationstransfers
Erfahrungen aus der Praxis schilderte Dr. Anna Kron, Kaufmännische Leitung des nationalen Netzwerkes Genomische Medizin: „Eine vernetzte, wissensgenerierende Versorgung, die – wie im DigiNet-Projekt – Patienten aktiv einbindet, ist der Schlüssel guter Behandlung. Damit Innovationen ihre volle Wirkung entfalten können, müssen sie dauerhaft im Gesundheitssystem verankert werden.“ Erfahrungen aus der Schweiz schilderte Matthias Früh, Leiter Gesundheitspolitik und Public Affairs der Helsana Gruppe: „Das Schweizer Gesundheitssystem bietet mit den Zusatzversicherungen und dem Vertrauensprinzip bei ärztlichen Behandlungen eine gute Grundlage für schnellen Zugang zu Innovationen. In der Praxis verzögern aber aufwendige Zulassungsverfahren und fehlende Tarife die Einführung neuer Behandlungsmöglichkeiten.“ Wie ein Innovationsfondsprojekt in die Praxis überführt werden kann, zeigte Prof. Dr. med. Thorsten Brenner, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Unimedizin Essen. „Der Innovationsfonds hat es uns ermöglicht, ein innovatives diagnostisches Tool nicht nur hinsichtlich der harten klinischen Endpunkte zu evaluieren, sondern gleichzeitig auch dessen Kosteneffektivität in Augenschein zu nehmen. Diese Sichtweise geht deutlich über den normalen Betrachtungshorizont von klinischen Studien hinaus und ist damit unmittelbarer Wegbereiter für den Transfer von wirklichen Innovationen in Richtung der Regelversorgung“, so Brenner, Konsortialführer des „DigiSep“-Projektes, welches sich mit einem Next Generation Sequencing (NGS)-basierten Verfahren zur Erregerdiagnostik bei Sepsis befasst hat.
Service für Redaktionen
Die Vorträge aller Referentinnen und Referenten finden Interessierte kurzfristig auf der Webseite des BARMER-Instituts für Gesundheitssystemforschung: BARMER Versorgungs- und Forschungskongress 2025.
Diese Pressemitteilung finden Interessierte unter: www.barmer.de/p029521.
__________________________________________
Presseabteilung der BARMER
Athanasios Drougias (Leitung), Telefon: 0800 33 30 04 99 14 21
Sunna Gieseke, Telefon: 0800 33 30 04 99 80 31
E-Mail: presse@barmer.de
www.barmer.de/presse – Bilder, Studien und den Gesundheits-Newsletter gibt’s im Presseportal.
https://x.com/BARMER_Presse – Folgen Sie uns auf X für tagesaktuelle Gesundheitsnews.
YouTube BARMER Presse – Livestreams, Pressekonferenzen und Statements finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.